Henning Eichberg ist tot. Der deutsch-dänische Historiker, Soziologe und politische Theoretiker starb nach langer und schwerer Krankheit am 22. April 2017 in seiner Wahlheimat Dänemark. Henning Eichberg wurde am 1. Dezember 1942 im schlesischen Schweidnitz (heute Polen) geboren.

Als Wissenschaftler war Henning Eichberg weltweit hoch angesehen, doch in Deutschland hatte er ab Ende der 1970er Jahre faktisch Berufsverbot. Um dennoch weiterhin wissenschaftlich arbeiten zu können, beschlossen seine damalige Ehefrau Greta und er zu Beginn der 1980er Jahre, Deutschland zu verlassen – und mit ihren drei Kindern nach Dänemark zu emigrieren. Dort engagierte sich Henning Eichberg in der „linksgrünen“ Socialistisk Folkeparti (SF), die seit 1990 mit der deutschen Linkspartei PDS (heute „Die Linke“) zusammenarbeitet. Mit dem langjährigen PDS-Vorsitzenden Lothar Bisky stand Henning Eichberg in freundschaftlichem Kontakt.
Die erste Begegnung
Als ich Henning Eichberg kennenlernte, war ich 17 Jahre alt – und von ihm fasziniert. Auf seine Schriften war ich ein Jahr vorher gestoßen. Henning Eichberg galt in „unseren“ Kreisen als intellektuelle „graue Eminenz“. Darum hatte ich ihn mir viel älter vorgestellt als er tatsächlich war. Nun staunte ich über sein jungenhaftes Gesicht – und den anscheinend fehlenden Bartwuchs. Was mich faszinierte? Henning Eichberg hatte auf viele Themen einen ganz neuen Blick. Bei ihm lösten sich vermeintliche Gegensätze einfach auf. So weckte Henning Eichberg mein Interesse für ganz unterschiedliche Themen: den neuen politischen Regionalismus, die Arbeiterkulturbewegung mit den Arbeiterweihespielen Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts sowie die Ideen des Anarcho-Syndikalismus – und anderes.
„Volklich“ statt „völkisch“
Henning Eichberg stellte das „Volk“ dem „Staat“ gegenüber – und zeigte den subversiven Gehalt des Volksbegriffs auf. Sein Credo lautete: „Wer nicht von den Völkern sprechen will, soll von den Menschen schweigen“. Dieses „volkliche“ Denken war stark beeinflusst von Martin Buber und N.F.S. Grundtvig. Das zeigte sich in der Debatte um die „Flüchtlingskrise“ ab 2015. Für Henning Eichberg gehörten die Migranten und Flüchtlinge zum Volk dazu. Darin drückte sich sein Verständnis von „Ethnopluralismus“ aus. Der Begriff war zwar von Henning Eichberg geprägt, aber später von vielen missverstanden oder – böswillig? – ins Gegenteil umgedeutet worden. Aber das ist eine andere Geschichte. Mit Tilman Zülch, dem langjährigen Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker, war Henning Eichberg eng verbunden.
Nationalrevolutionäre Phase
Ende 1974 schloss ich mich einer Organisation an, die sich als „nationalrevolutionär“ bezeichnete: „Sache des Volkes/NRAO“ (das heutige Plagiat gleichen Namens hat damit nichts zu tun). Teile des Programms waren von Henning Eichberg formuliert worden. Es ging um die „deutsche Frage“ – und um einiges mehr. So forderten wir u.a. die Abschaffung alliierter Vorbehaltsrechte, solidarisierten uns mit Befreiungsbewegungen in der sogenannten „Dritten Welt“, unterstützten den Kampf der IRA in Nordirland, der Kurden gegen das Regime im Irak – und beteiligten uns an Demonstrationen gegen die „imperialistischen Supermächte“ USA und UdSSR. Politischer Romantizismus war dabei natürlich mit im Spiel.
1978 heirateten meine Freundin und ich. Die Feier fand in der Wohnung von Henning Eichberg und seiner Frau Greta in Murrhardt (Baden-Württemberg) statt. Henning Eichberg war einer der beiden Trauzeugen. Der zweite Trauzeuge war Georgwilhelm Burre, ein Kämpfer für die sozialpolitischen Interessen der Künstler.
Exkurs I: Georgwilhelm Burre
Georgwilhelm Burre war Direktor der Allgemeinen Rentenversicherung AG in München und engagierte sich später als Geschäftsführer des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks für die sozialen Interessen der Schauspieler. Seit den frühen 1970er Jahren setzte er sich auch politisch dafür ein, dass die „freien“ Schauspieler und andere Künstler unter dem Schirm der gesetzlichen Sozialversicherung Platz fanden. Mit Erfolg. Seine Argumente fanden in Bonn Gehör. Dadurch wurde Georgwilhelm Burre zu einem wichtigen Wegbereiter der heutigen gesetzlichen Künstlersozialkasse.
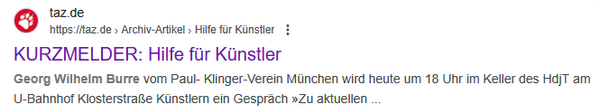
Georgwilhelm Burre kam aus der DDR. Er war aus politischen Gründen in Bautzen inhaftiert gewesen. Als ich einmal zum Abschluss einer Veranstaltung die Melodie der „Internationalen“ auf dem Klavier spielte, reagierte er empört. Von kommunistischen Ideen hatte er die Nase voll. Georgwilhelm Burre schloss sich früh der „Nationaldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD) an. Die Partei war im Jahr 1964 gegründet worden.
Wer das heute – viele Jahrzehnte später – liest, schüttelt vielleicht den Kopf, weil es kaum zu verstehen ist. Dazu muss man wissen, dass die NPD der 1960er Jahre eine Partei mit sehr heterogener Anhängerschaft war. Das einigende Band war die Hoffnung auf ein wiedervereinigtes Deutschland und die Überwindung der deutschen Teilung. In der Partei kamen Menschen zusammen, die nicht zusammen passten, weil sie in anderen wichtigen Fragen oft entgegengesetzte Auffassungen vertraten. Aber das ist eine andere Geschichte. Mehr dazu in: Verfassungsfeinde.
Exkurs II: Adolf von Thadden
Bei der Gründung der NPD fiel Adolf von Thadden die Hauptrolle zu. Er war bis 1971 Vorsitzender der Partei und verließ die NPD, als sich die Partei dem Herausgeber der Deutschen National-Zeitung, Gerhard Frey, öffnete. Adolf von Thadden war trotz seiner politischen Stellung gesellschaftlich weitgehend anerkannt. Es erscheint heute unvorstellbar, dass der Vorsitzende einer Partei, die als rechtsradikal gilt, in dem Programmheft eines Evangelischen Kirchentages Gelegenheit erhält, sich mit einem Grußwort an dessen Teilnehmer zu wenden. Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, der 1969 in Stuttgart stattfand, war dies der Fall. Im Programmheft war der NPD-Vorsitzende, Adolf von Thadden, mit einem Beitrag vertreten.
Wenn sich die Besucher dieses Kirchentages später mit Grausen an die Tage in Stuttgart erinnerten, lag das nicht an der Person Adolf von Thaddens, sondern an einem Mann, der auf dem Kirchentag einen öffentlichen Suizid verübt hatte. Mit den Worten: „Ich grüße meine Kameraden der SS“ trank er vor rund zweitausend Zuschauern eine mit Zyankali gefüllte Kapsel aus. Es handelte sich um den Vater der heutigen Publizistin Ute Scheub. Die Tochter schrieb sich die Geschichte ihres Vaters Jahrzehnte später von der Seele. Ihr Buch „Das falsche Leben“ erschien im Jahr 2006.
Adolf von Thadden, der die große Mehrheit der früheren Wehrmachtssoldaten stets verteidigte, ließ nie einen Zweifel aufkommen, wie ablehnend er dem NS-Regime gegenüber stand. Beispielhaft dafür ist seine Äußerung in einer Podiumsdiskussion, die 1966 in der Hamburger Universität stattfand („… für die Millionenzahl der deutschen Soldaten nicht darum ging, ein Regime zu verteidigen, dass Juden in einer Form, in einer Weise, in einer Zahl umgebracht hat, dass dieser Makel lange, lange auf unserem Volk liegen wird …“), und die auch den Wertekanon der Familie von Thadden widerspiegelt.
Eine Schwester Adolf von Thaddens war die Pädagogin Elisabeth von Thadden, zu der Adolf von Thadden nach seinen Worten ein enges Verhältnis hatte. Elisabeth von Thadden war von den Nazis am 8. September 1944 in Plötzensee als Regimegegnerin hingerichtet worden. Als Adolf von Thadden die Nachricht vom Tod seiner Schwester erhielt, stand er in Ungarn als Adjutant einer Sturmgeschütz-Brigade sowjetischen Truppen gegenüber. Anscheinend trug er sich angesichts dieser Nachricht kurzzeitig mit dem Gedanken, die Uniform des Staates, der seine Schwester hingerichtet hatte, auszuziehen.
Der deutlich ältere Bruder, Reinold von Thadden-Trieglaff, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee eines Deutschen Evangelischen Kirchentages entwickelt und war auch dessen erster Präsident geworden.
Aktion Neue Rechte (ANR)
Im Jahr 1972 verließ Georgwilhelm Burre die NPD, um mit Henning Eichberg und anderen die „Aktion Neue Rechte“ (ANR) ins Leben zu rufen. Deren Generalsekretär wurde Georgwilhelm Burre. Sein Anti-Kommunismus war gespeist von den Erfahrungen in der DDR und den Erlebnissen als Häftling in Bautzen. Das erklärt auch, warum er 1973 auf eigene Faust das Gespräch mit Italiens Neofaschisten suchte. Sein Besuch in Rom wurde innerhalb der ANR heftig kritisiert und fand keine Fortsetzung. Bild: Georgwilhelm Burre (rechts) mit dem damaligen Vorsitzenden des italienischen MSI, Georgio Almirante.
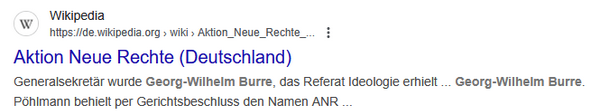
Zu dieser Zeit trat ich der Jugendorganisation der Partei bei. Nachdem die ANR bald darauf an ihren inneren Widersprüchen zerbrochen war, beteiligten sich Georgwilhelm Burre und Henning Eichberg an der Gründung der „Sache des Volkes/NRAO“. Wieder wurde Georgwilhelm Burre der Generalsekretär. Sein Besuch in Rom war vergeben und vergessen. Im Herbst 1974 schloss auch ich mich dieser Organisation an.
Freundschaft
In den 1970er und frühen 1980er Jahren wurde Henning Eichberg von mir wie ein „Guru“ verehrt. Aber das wollte er sicherlich nicht sein. Im Gegenteil: Henning Eichberg stellte die eigene Position regelmäßig selbst in Frage. Die Gegenargumente nahm er auf und stimmte ihnen nicht selten sogar zu. Umso größer war dann das Erstaunen, wenn sich im Verlauf der weiteren Diskussion viele dieser Gegenargumente in Luft auflösten.
Das war nicht ein rhetorischer „Trick“, sondern Teil seiner Gesprächskultur – und Ausdruck seines offenen Wesens. Umso leichter verlor er bei früheren Weggefährten, von denen er sich politisch entfernt hatte, die Geduld. Das geschah aus tiefer Verbundenheit. Er hätte diese Freunde gerne auf seinem Weg „mitgenommen“.
Entfremdung
1979 verabschiedeten sich Henning Eichberg und ich von der „Sache des Volkes/NRAO“, die sich bald darauf ohnehin auflöste. Henning Eichberg engagierte sich für kurze Zeit im Umfeld der GRÜNEN; ich selbst schloss mich in West-Berlin der „Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz“ (AL) – dem späteren Berliner Landesverband von „Bündnis 90 – DIE GRÜNEN“ – an. Durch die Zeitschrift wir selbst, bei der ich bis Ende der 1990er Jahre mitarbeitete, blieben wir noch ein paar Jahre miteinander verbunden, doch dann trennten sich unsere Wege. Das hatte einen privaten und einen politischen Grund. Ich unterstützte damals den Chefredakteur der Zeitung „JUNGE FREIHEIT“, Dieter Stein.
Dieter Stein war damals einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der „JUNGEN FREIHEIT“ gewesen. Dem zweiten Gesellschafter traute ich politisch nicht über den Weg. Deshalb half ich Dieter Stein, sich von diesem Gesellschafter zu trennen. Ich hoffte, dass sich die Zeitung dadurch in Richtung der damaligen PDS („DIE LINKE“) öffnen könne und verfasste zu diesem Zweck einige Artikel für die Zeitung. Henning Eichberg warf mir vor, mich auf ein „rechtsreaktionäres“ Blatt eingelassen zu haben. Der Kontakt brach ab. Erst 17 Jahre später begegneten wir uns wieder. Allerdings nur indirekt: Wir hatten fast zeitgleich Aufsätze zur Flüchtlings- und Zuwanderungsfrage im OnlineMagazin „Globkult“ veröffentlicht. Deren damaliger Herausgeber war der Historiker Prof. Dr. Peter Brandt. Henning Eichberg plädierte in seinem Aufsatz (Die anderen und wir selbst) für einen „Willkommens-Nationalismus“. In meinem Aufsatz ging es um rassistische Aussagen und um Defizite in der Flüchtlings-Debatte (Sind wir selbst ein Integrationshindernis?). In „Globkult“ kamen Henning Eichberg und ich uns wieder etwas näher.
Gemeinsamer Freund
Peter Brandt und Henning Eichberg hatten sich 1980 in meiner Wohnung in West-Berlin kennengelernt – und pflegten seitdem den Gedankenaustausch. Peter Brandt hat im Online-Magazin Globkult das Lebenswerk dieses Wissenschaftlers und politischen Theoretikers gewürdigt und darauf hingewiesen, wie sehr Henning Eichberg von seiner späteren Ehefrau Kirsten Kaya Roessler gestützt worden war (Peter Brandt: Nachruf auf den originellen Querdenker Henning Eichberg).
Umstritten
Henning Eichberg war als Wissenschaftler weltweit anerkannt, in Deutschland jedoch bis zuletzt politisch umstritten. Seine geistige Beweglichkeit passte nicht in das obrigkeitsstaatliche Denken, das in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Umso mehr war Henning Eichberg von der demokratischen Kultur Dänemarks fasziniert. Henning Eichberg war ein Radikaler – aber ein ganz sanfter.
